Zugewinngemeinschaft § Rechtslage & Zugewinnausgleich
Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand von Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern, sofern diese keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. In einem Ehevertrag kann eine modifizierte Zugewinngemeinschaft, eine Gütertrennung oder Gütergemeinschaft vereinbart werden. Bei der Zugewinngemeinschaft bleiben die jeweiligen Güter der Partner während der Ehe getrennt voneinander. Wird die Ehe geschieden oder stirbt ein Ehepartner, erfolgt ein Zugewinnausgleich. Doch was ist der gesetzliche Güterstand? Und was ist ein Zugewinn in der Ehe? Im folgenden Artikel erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Zugewinngemeinschaft bei Scheidung.
- Lesezeit: 10 Minuten
- 30 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.

Familienrecht Redaktion
in der Ehe trennen?
- 1. Ort in Suchfeld eingeben
- 2. Anwälte vergleichen
- 3. Anwalt auswählen
- 4. Unverbindliche Anfrage stellen
- Bei Scheidung oder Tod erfolgt ein Zugewinnausgleich, d.h. die ehelichen Ersparnisse und das Gebrauchsvermögen werden aufgeteilt.
- Dinge des persönlichen Gebrauchs, Arbeitsmittel, Unternehmenswerte und Surrogate sind von der Vermögensaufteilung bei Scheidung
Rechtslage zur Zugewinngemeinschaft
Wenn Partner ohne Ehevertrag heiraten, tritt ihre Ehe automatisch in die sogenannte Zugewinngemeinschaft ein. Sie ist eine Unterkategorie der Gütertrennung im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch und zugleich der gesetzliche Güterstand in Österreich. Unter dem Konzept der Zugewinngemeinschaft bleibt das Vermögen der Ehegatten getrennt und die finanziellen Verhältnisse der beiden Ehepartner ändern sich nicht bei einer Heirat. Die Zugewinngemeinschaft definiert sich demnach über drei Kriterien:
- getrenntes Vermögen
- keine Übernahme von Schulden
- keine alleinige Verfügung über den Besitz
Per Ehevertrag können die Eheleute jedoch zum Beispiel in den Güterstand der Gütergemeinschaft treten. Das während der Ehe erworbene Vermögen steht den Eheleuten damit gemeinschaftlich zu. Vereinbaren die Ehepartner Zugewinngemeinschaft, profitiert der Partner, der finanziell schlechter gestellt ist. Nach der Scheidung steht ihm ein Zugewinnausgleich zu. Die Zugewinngemeinschaft endet grundsätzlich im Falle einer Scheidung oder des Todes eines der Ehepartner.
Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung
Das Eherecht regelt die vermögensrechtlichen Beziehungen des ehelichen Vermögens zwischen den beiden Eheleuten. Laut österreichischer Gesetzgebung gilt der gesetzliche Güterstand der Gütertrennung. Ebenso gilt die Gütertrennung bei eingetragener Partnerschaft und Gütertrennung bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft. Anhand eines Ehevertrags kann jedoch eine modifizierte Zugewinngemeinschaft oder Gütergemeinschaft vereinbart werden.
Die Gütertrennung sieht vor, dass die Eheleute Eigentümer ihres Vermögens bleiben, welches in die Ehe eingebracht wird als auch während der Ehe erworben wurde. Demzufolge verwalten die Eheleute ihr Vermögen und haften Zugewinngemeinschaft für ihre Schulden. Erst bei einer Scheidung erfolgt ein Zugewinnausgleich, d.h. das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse werden aufgeteilt.
Definition der Zugewinngemeinschaft
Sofern die Eheleute keine anderen Vereinbarungen in einem Ehevertrag getroffen haben, leben sie im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, welche am Tag der Eheschließung beginnt und mit der rechtskräftigen Scheidung endet. Das Vermögen am Tag der Eheschließung wird Anfangsvermögen genannt und das Vermögen am Tag der Zustellung des Scheidungsantrages wird als Endvermögen bezeichnet. Ist das Endvermögen eines Ehepartners höher als dessen Anfangsvermögen, spricht man vom Zugewinn. Ist der Zugewinn eines Ehepartners höher als der Zugewinn des anderen, ist die Differenz hälftig auszugleichen; dies ist Zugewinnausgleich.
Definition der modifizierten Zugewinngemeinschaft
Anhand der modifizierten Zugewinngemeinschaft kann der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft ausgestaltet und verändert werden. In einem Ehevertrag kann ein Zugewinnausgleich ausgeschlossen werden, wodurch eine Verfügungsbeschränkung erreicht wird. Meist wird die Zugewinngemeinschaft nur bei Scheidung ausgeschlossen, nicht aber bei einem Erbfall oder Tod.
Weitere Informationen zum Thema Zugewinngemeinschaft und Erbe erhalten Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Artikels. Bei einer modifizierten Zugewinngemeinschaft können auch Vereinbarungen über die Feststellung und Bewertung des Anfangs– und Endvermögens getroffen werden. Andernfalls kann auch die Herausnahme einzelner Vermögensgegenstände aus dem Zugewinnausgleich vereinbart werden. Ein Ehevertrag für Unternehmer ist daher ratsam, um das Betriebsvermögen nicht in den Zugewinn fallen zu lassen.
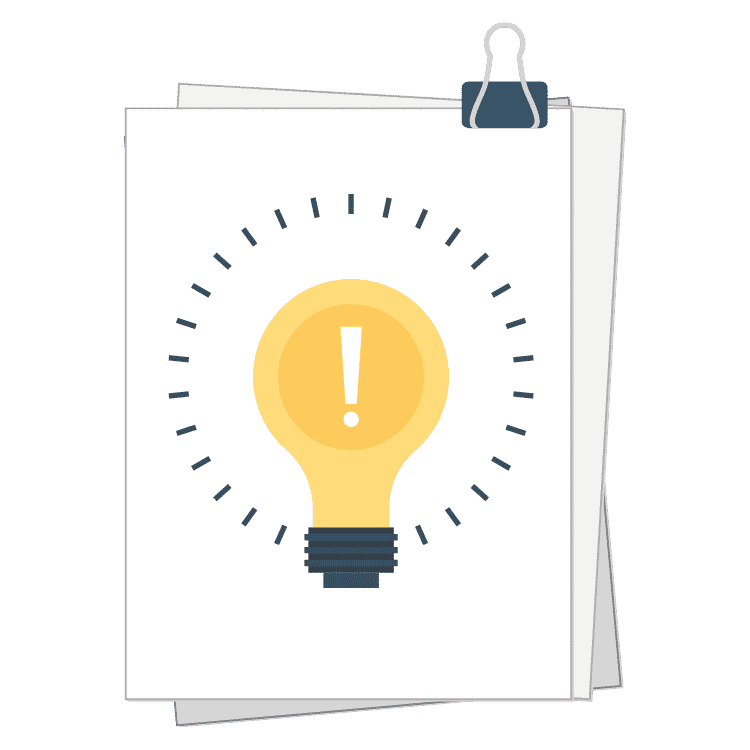
Bei der Vermögensaufteilung in Österreich spielt es keine Rolle, wie die Aufteilung des Vermögens bzw. des Eigentums während der Ehe aussah. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Ehegatte Alleineigentümer einer Wohnung oder eines Hauses ist, denn auch in diesem Fall muss das Eigentum gerecht zwischen den Eheleuten aufgeteilt werden.
Was wird beim Zugewinnausgleich bei einer Scheidung geteilt?
Bei Scheidung wird ein Zugewinnausgleich vorgenommen und der Zugewinn geteilt, doch was wird beim Zugewinnausgleich bei einer Scheidung tatsächlich geteilt? Neben der Vermögensaufteilung bei Trennung und den Unterhaltsfragen spielt auch der Zugewinnausgleich eine entscheidende Rolle. Hierbei soll das Vermögen nach der Scheidung gerecht aufgeteilt werden. Mit Zugewinn ist das Vermögen gemeint, das ein Ehepartner oder beide gemeinsam während der Ehe erworben haben. Hinsichtlich des Zeitraums ist das Datum der Heirat und der Zeitpunkt der Vermögensaufteilung in Österreich entscheidend.
Dabei liegt der Stichtag entweder in einem gerichtlichen Aufteilungsverfahren nach der Scheidung oder zum Zeitpunkt der einvernehmlichen Scheidung, wenn die Eheleute die Vermögensaufteilung einvernehmlich regeln möchten. Ist jedoch ein Ehegatte bereits vor der Scheidung ausgezogen, gilt der Tag der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft als Stichtag für den Zugewinnausgleich. Allerdings wird nur das Vermögen aufgeteilt, welches im weitesten Sinne von beiden Partnern erwirtschaftet wurde. Aus diesem Grund gibt es Ausnahmeregelungen zur Vermögensaufteilung in Österreich.
Welches Vermögen ist vom Zugewinnausgleich ausgeschlossen?
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass jegliches Vermögen, welches von den Ehegatten zwischen den Stichtagen erworben wurde, aufgeteilt wird. Doch welches Vermögen ist vom Zugewinnausgleich ausgeschlossen? Jegliches Vermögen, das in die Ehe eingebracht wurde, d.h. das Vermögen, das die Ehepartner bereits vor der Ehe besessen haben, ist von der Vermögensaufteilung ausgeschlossen. Gleiches gilt für Vermögenswerte, die ein Ehepartner vor oder während der Ehe geerbt oder geschenkt bekommen hat, Sachen des persönlichen Gebrauchs oder der Berufsausübung, sowie Vermögenswerte, die zu einem Unternehmen gehören.
Ebenso sind Unternehmensanteile ausgeschlossen, sofern sie nicht bloße Wertanlagen sind. Diese Regelungen wurden vom Gesetzgeber getroffen, um das Vermögen eines Unternehmens bei einer Scheidung nicht zu gefährden und nur Vermögen in die Aufteilung einzubringen, zu dessen Erwerb beide Ehepartner beigetragen haben. Deswegen entfallen Schenkungen und Erbschaften aus der Vermögensaufteilung in Österreich.
Zugewinnausgleich berechnen?
- Anwalt mit Expertise kontaktieren
- Vermögensverhältnisse klarstellen

Surrogate
Ebenso sind klar abgrenzbare Surrogate (Ersatz) von der Vermögensaufteilung bei Scheidung ausgeschlossen. Als Surrogate bezeichnet man laut Zivilrecht den Ersatz eines Vermögensgegenstands durch einen anderen Gegenstand oder eine Ersatzforderung. Besaß ein Partner vor der Ehe ein Ferienhaus, das während der Ehe verkauft wurde, ist der Erlös (Surrogat) des Hauses bei Scheidung von der Aufteilung ausgeschlossen.
Dinge des persönlichen Gebrauchs
Als Dinge des persönlichen Gebrauchs oder persönliche Gegenstände betrachtet man Kleidung, Schmuck, Smartphones, Laptops und spezielle Sport- und Hobbyausrüstungen. Ebenso sind Schmerzensgeldzahlungen von der Vermögensaufteilung bei Trennung ausgeschlossen.
Unternehmenswerte
Als Unternehmenswert wird jeglicher Gewinn aus selbstständiger Erwerbstätigkeit bezeichnet. Anteile an einer GmbH oder KG sind reine Wertanlagen und unterliegen daher der Vermögensaufteilung in Österreich, sofern die Unternehmensführung nicht davon beeinflusst ist. Nicht selten kommt es zur Exemtion, hierbei wird das eheliche Vermögen in das Unternehmen investiert, um es der Vermögensaufteilung zu entziehen. Diese Begünstigung des Unternehmensinhabers gegenüber des anderen Ehepartners wird jedoch rechtlich kontrolliert. Vermögensverschiebungen vom Privat- ins Unternehmensvermögen werden bei der Vermögensaufteilung bei Scheidung berücksichtigt, allerdings darf der Unternehmensbestand dadurch nicht gefährdet sein.
Relevante Faktoren beim Zugewinnausgleich
Die Schuldfrage spielt bei der Vermögensaufteilung keine Rolle, doch welche Faktoren sind relevant beim Zugewinnausgleich? Bei der Vermögensaufteilung wird das Vermögen nach den „Beiträgen der Eheleute“ aufgeteilt, d.h. hierbei geht es nicht nur um einen Finanzbeitrag, sondern auch um die Haushaltsführung, Kindererziehung, Unterhaltsleistungen und Mithilfe im Familienbetrieb.
Besteht ein außerordentliches Missverhältnis, geht man von der Gleichwertigkeit der Beiträge aus und teilt das Vermögen im Verhältnis 50:50. Gleiches gilt, wenn die Ehefrau nicht erwerbstätig war und der andere Ehepartner Alleinverdiener war. Des Weiteren liegt der Rechtsprechung das Wohl der Kinder am Herzen. Prinzipiell spielt die Schuld des Scheiterns einer Ehe bei der Vermögensaufteilung bei Trennung keine Rolle, jedoch gibt es eine Ausnahme. Werden Vermögenswerte bei einer Scheidung übernommen, so hat der Ehepartner, der weniger oder keine Schuld am Scheitern der Ehe hat, Vorrang.
Vermögenswerte während der Ehe und der Zugewinnausgleich
Unwesentlich ist auch, in wessen Eigentum ein Vermögenswert während der aufrechten Ehe stand. Selbst wenn ein Ehepartner Alleineigentümer einer Immobilie ist, wird diese bei der Scheidung bei der Aufteilung berücksichtigt. Da während der Ehe Einvernehmen darüber bestand, dass die Frau den Haushalt führt während der Mann arbeitet, wird der Beitrag zur Vermögensbeschaffung von rechtlicher Seite als gleichwertig betrachtet.
Beträgt der Wert der Immobilie abzüglich der Finanzierungsverbindlichkeiten noch 200.000 Euro, dann wird der Wert zur Hälfte zwischen beiden Eheleuten geteilt. Möchte ein Ehepartner die Ehewohnung behalten, muss er dem anderen Ehepartner den Anteil auszahlen und gegebenenfalls den Kredit alleine bezahlen. Möchten beide Eheleute die Wohnung behalten, hat derjenige das Wahlrecht, der weniger Schuld am Scheitern der Ehe trägt.
Nichtsdestotrotz nimmt die Ehewohnung einen besonderen Anspruch bei der Rechtsprechung ein, denn es wird immer geprüft, ob ein Ehegatte einen existentiellen Bedarf hat oder ob gemeinsame Kinder ein Interesse an der Nutzung der Wohnung haben. Das Wohl der Kinder steht dabei im Vordergrund. Sind die Kinder noch minderjährig befindet sich das soziale Umfeld und die Schule meist in der Nähe des Wohnorts. Ein Umzug würde das soziale Gefüge und die Bindung der Kinder zum Heimatort gefährden. Diese Konsequenzen werden beim Aufteilungsverfahren berücksichtigt und bestmöglich verhindert.
Unternehmen und deren Vermögen beim Zugewinnausgleich
Was geschieht beim Zugewinnausgleich mit Unternehmen und deren Vermögen? Nicht selten kommt es vor, dass ein Ehepartner aufgrund der bevorstehenden Scheidung das Vermögen umschichtet. Das heißt, dass Privatvermögen meist als Unternehmensvermögen „beiseite geschafft wird“. Dadurch wäre der andere Ehepartner benachteiligt, weil das Vermögen bei der Vermögensaufteilung bei Trennung nicht berücksichtigt werden würde.
Doch das Gesetz verhindert jene Benachteiligung, indem keine ungewöhnliche Vermögensverringerung ohne die Zustimmung des anderen Ehepartners innerhalb der letzten 2 Jahren vor der Scheidungsklage erfolgen darf. Besteht jene Zustimmung nicht, wird das Vermögen bei der Aufteilung einkalkuliert. Fand eine Investition von ehelichem Vermögen in ein Unternehmen statt, muss der Wert des investierten Vermögens bei der Aufteilung enthalten sein. Wird Vermögen aus einem Unternehmen auch privat genutzt, findet ebenfalls ein Zugewinnausgleich statt.
Zugewinngemeinschaft und Erbe
Das Erbe in der Zugewinngemeinschaft zwischen Heirat und Beantragung der Scheidung gehört dem Erben. Erhält ein Ehepartner in der Ehe ein Erbe, dann gehört ihm die Erbschaft allein und der andere Ehepartner hat keinen Anspruch darauf. An diesem Verhältnis von Zugewinngemeinschaft und Erbe ändert sich auch nichts, wenn das Erbe für gemeinsame Zwecke verwendet wird. Denn im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gibt es kein gemeinsames Vermögen und jeder Ehegatte ist Eigentümer seines eigenen Vermögens.
Ebenso fällt das Erbe in der Zugewinngemeinschaft nicht in den Zugewinnausgleich bei Scheidung. Bei einer Scheidung wird nur der Vermögenszuwachs ausgeglichen, was wiederum nicht auf einen Vermögenserwerb durch Erbschaft zutrifft. In der Zugewinngemeinschaft wird das Erbe dem Anfangsvermögen zugerechnet. Ist das Erbe bei Zustellung des Scheidungsantrags noch vorhanden, ergibt sich kein Vermögenszuwachs, sodass das Erbe in der Zugewinngemeinschaft bzw. beim Zugewinn neutral ist.
Zugewinngemeinschaft und Schulden
Grundsätzlich haften die jeweiligen Parteien nach der Scheidung für ihre eigenen Schulden. Allerdings gibt es im Zusammenhang Zugewinngemeinschaft und Schulden eine Ausnahme – die Solidarhaftung. Bei der Solidarschuld haften beide Eheleute oder mehrere Personen für die gesamten Forderungen. Darüber hinaus werden Kredite, die zur Deckung des ehelichen Lebensaufwands aufgenommen wurden (z.B. die Finanzierung eines gemeinsamen Urlaubs) aufgeteilt.
Wurde jedoch Gebrauchsvermögen mit einem Kredit finanziert (z.B. der Kauf eines Autos oder der Eigentumswohnung), muss der Ehepartner, der den Vermögenswert erhält, auch die Tilgung übernehmen. Allerdings kann das Gericht anordnen, dass ein Ehepartner Hauptschuldner und der andere Ausfallbürge eines Kredits ist. Besonders kompliziert wird es bei der Zugewinngemeinschaft mit Schulden und der Vermögensaufteilung mit Haus oder Immobilie.
Berechnungsbeispiel des Zugewinnausgleichs
Der folgende Abschnitt bietet Ihnen jeweils ein Beispiel zur Berechnung des Zugewinnausgleichs. Das erste Beispiel zeigt, wie die Verrechnung des Zugewinns erfolgt, wenn keine Schulden mehr vorhanden sind und das zweite Beispiel zur Berechnung des Zugewinnausgleichs erläutert, wie Schulden bei der Zugewinngemeinschaft berücksichtigt werden.
Beispiel A:
Herr Müller hat zum Zeitpunkt der Eheschließung über 50.000 Euro Schulden. Während der Ehe erwirtschaftet er allerdings 80.000 Euro, sodass sein Endvermögen 30.000 Euro beträgt. Die Ehefrau war jedoch bei der Eheschließung vollkommen schuldenfrei und erzielte ein Endvermögen von 100.000 Euro. Demnach beträgt der Zugewinn von Herrn Müller 80.000 Euro und der Zugewinn von Frau Müller 100.000 Euro. Der Zugewinn der Ehefrau übersteigt den ihres Mannes um 20.000 Euro. Der Zugewinn von Frau Müller übersteigt den ihres Mannes um 20.000 Euro, deswegen muss sie die Hälfte ihres Überschusses in Höhe 10.000 Euro als Zugewinnausgleich an ihren Mann zahlen.
Beispiel B:
Herr Müller hat zum Zeitpunkt der Eheschließung über 80.000 Euro Schulden. Während der Ehe erwirtschaftet er allerdings 40.000 Euro, sodass er weiterhin mit 40.000 Euro verschuldet ist. Die Ehefrau war jedoch bei der Eheschließung vollkommen schuldenfrei und erzielte ein Endvermögen von 100.000 Euro. Der Abbau der Schulden in der Zugewinngemeinschaft wird als wirtschaftlicher Zugewinn in Höhe von 40.000 Euro gerechnet. Der Zugewinn der Ehefrau übersteigt den ihres Mannes um 60.000 Euro, daher muss sie die Hälfte ihres Überschusses in Höhe von 30.000 Euro als Zugewinnausgleich an ihren Mann zahlen.
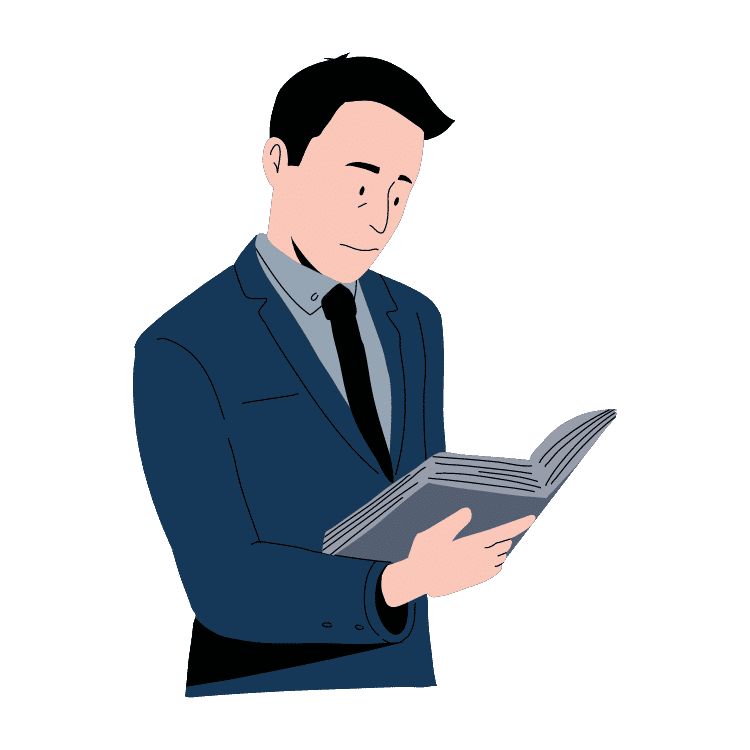
Finden Sie den passenden Anwalt für Familienrecht
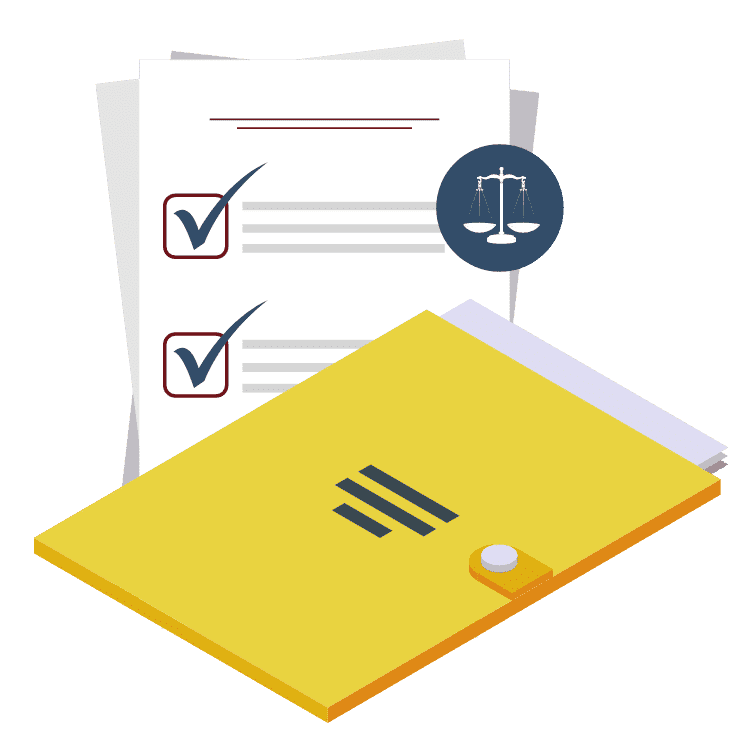
Finden Sie weitere Ratgeber zum Güterrecht in Österreich

Finden Sie in unserer Anwaltssuche den passenden Anwalt
- PDF Download


